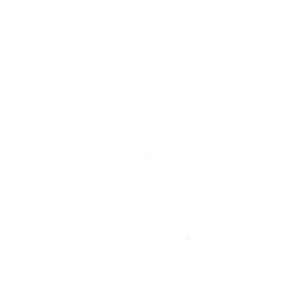Eine kleine Rauferei, juckende Haut im Fellwechsel der Pferde oder die neue Ausrüstung sitzt schlecht – Wunden und kleinere Verletzungen sind im Pferdealltag schnell passiert. Doch womit versorgt man verletzte Haut am besten? In diesem Artikel erfährst Du alles über die Wundheilung und Wundversorgung bei Pferden.
Ursachen und typische Symptome von Wunden beim Pferd
Ursachen von Wunden beim Pferd
Es gibt verschiedene Ursachen, wie ein Pferd sich Wunden zuziehen kann. Handelt es sich um eine Schnittwunde, sind meist scharfe Gegenstände die Ursache. Platzwunden treten oft durch stumpfe Traumata auf, Quetschwunden können beispielsweise bei Unfällen entstehen. Biss- und Risswunden können zum Beispiel bei Rangeleien mehrerer Pferde auf der Wiese entstehen.

Biss- und Risswunden können zum Beispiel bei Rangeleien mehrerer Pferde auf der Wiese entstehen.
Wichtig – Hat Dein Pferd sich beispielsweise auf der Wiese oder in der Box verletzt, solltest Du die Ursache ausfindig machen. Sind auf der Wiese spitze Gegenstände oder guckt ein Nagel aus einer Boxenwand, reagiere am besten sofort und beseitige die Gefahr.
Symptome – So erkennst Du Wunden
In der Regel sind die Verletzungen bei unseren Vierbeinern gut zu erkennen. Handelt es sich jedoch um kleinere Wunden, sind diese oftmals im Fell versteckt und nicht sofort ersichtlich. Gerade unter dem dicken Winterfell fallen diese nicht direkt auf. Sie machen sich manchmal erst bemerkbar, wenn das Pferd ein dickes Bein hat, lahmt oder sogar Fieber bekommt. Ist das der Fall, solltest Du Dein Pferd nach einer Wunde absuchen, da diese die primäre Ursache von solchen Symptomen sein kann.
Wie lange dauert die Wundheilung beim Pferd?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt darauf an, wie tief die Wunde ist und wie die Wundheilung verläuft.
Erste Hilfe bei einer Wunde
Hat sich Dein Pferd eine oberflächliche Wunde zugezogen, solltest Du diese im besten Fall erst einmal selbst versorgen. Dafür kannst Du als erste Maßnahme ein antiseptisches Produkt verwenden, das desinfizierend wirkt, wie beispielsweise Produkte mit hypochloriger Säure. Ein solches Produkt sollte hautpflegende Eigenschaften mit antiseptischen Komponenten besitzen.
Dieser erste Schritt ist sehr wichtig, da sich überall Keime oder andere Krankheitserreger befinden. Gelangen sie in die frische Wunde, kann die Wundheilung stark gestört werden. Halte die Wunde nach der Versorgung stets im Blick und kontrolliere den Heilungsverlauf.
Wichtige Information: Bist Du Dir unsicher und befürchtest, dass die Wunde sehr tief ist, schalte sofort einen Tierarzt ein und sorge damit für eine professionelle Behandlung. Gerade bei Verletzungen am Pferdebein gilt Vorsicht. Denn bereits kleinste Wunden können Phlegmone (Einschüsse) auslösen. Wenn die Wunde sehr tief ist, kann sie also nicht nur die Haut betreffen, sondern birgt eine größere Gefahr für das Pferd. Stellst Du bei der Wunde Eiter, einen extremen Geruch oder eine Schwellung fest, solltest Du ebenfalls einen Tierarzt rufen. Gleiches gilt, wenn der Vierbeiner im Bereich der Wunde sehr druckempfindlich ist.
Hypochlorige Säure als Wundpflegemittel erster Wahl
Neben einer breiten keimabtötenden Wirkung sollte ein ideales Wundantiseptikum unter anderem schnell und effektiv wirken, schmerzfrei anwendbar sein, farblos, nicht gewebeschädigend oder anderweitig schädlich sein (z. B. Allergien auslösen) und die Wundheilung fördern.
Diese Eigenschaften vereinen Wundpflegemittel mit hypochloriger Säure. So ist es auch nicht verwunderlich, dass hypochlorige Säure bei Experten zu den Wundantiseptika der ersten Wahl gehört. Diese moderne Substanz ist trotz ihres “reizenden” Namens mild zu körpereigenem Gewebe und zeigt dabei eine effektive Wirkung gegen Bakterien, Viren und Pilze. Viele herkömmliche Mittel, wie Blau- und Silbersprays, Wasserstoffperoxid, Octenidin oder Jod haben den großen Nachteil, dass sie die Wundheilung verzögern oder gar gewebeschädigend sein können.
Was tun bei offener Wunde beim Pferd?
Hat Dein Pferd eine offene Wunde, solltest Du diese zunächst ausspülen und mit einem Antiseptikum behandeln.
Die Phasen der Wundheilung beim Pferd
Der Heilungsprozess einer Wunde beim Pferd teilt sich in drei Phasen auf: Exsudationsphase, Granulationsphase und Ephitelphase.

Der Heilungsprozess einer Wunde beim Pferd teilt sich in drei Phasen auf
Exsudationsphase
In dieser Phase versucht der Pferdekörper alles loszuwerden, was nicht in der Wunde sein soll. Dazu gehören Bakterien, Keime, Fremdkörper, Schmutz, abgestorbenes Gewebe oder koagulierendes Blut. Dabei blutet die Wunde beim Pferd meist stärker oder Exsudat wird als Flüssigkeit generiert. Die Flüssigkeiten spülen die Wunde sozusagen und sorgen für eine Reinigung dieser. In der Regel meistert der Pferdekörper das allein. Ist die Wunde aber extrem verschmutzt, solltest Du das Abfließen der Sekrete unterstützen.
Granulationsphase
In dieser Phase beginnt der Heilungsprozess der Wunde. Dafür bildet sich Granulationsgewebe und die Wunde heilt von außen nach innen. Oftmals siehst Du in der Phase einen weißen Rand um das rote Wundgewebe. Dieser Rand ist (junges) Bindegewebe, das der Körper bildet, um die Wunde des Pferdes zu schließen. Bei kleineren Wunden bildet sich oft Schorf, der sie schützt. Bei größeren Verletzungen bildet sich hingegen ein schützender Film, der leicht glänzt und die Wund schützt. Dieser besteht aus Blutplättchen, die die Regeneration beschleunigen. Wichtig ist, dass Du die eingeleitete Wundheilung nicht störst.
Ephitelphase
In dieser Phase beginnt die Wunde, sich zu verschließen und eine feste Deckschicht zu bekommen. War die Wunde vorher noch nass, trocknet sie jetzt meist. Nach und nach wird sie fester. Trotzdem solltest Du nach wie vor gut aufpassen, da das Bindegewebe noch sehr dünn ist. Dementsprechend hält es noch keine starken Belastungen aus. Erst wenn mehrere Schichten entstanden sind, kann die Pferdehaut widerstandsfähiger werden. Beobachte die Wunde auch in dieser Phase gut und kontrolliere den Heilungsprozess der Wunde.
Wann muss eine Wunde beim Pferd genäht werden?
Handelt es sich um sehr große Wunde, Risse oder Schnitte, muss ein Tierarzt diese oftmals nähen.